Stefan Jäger – ein spätimpressionistischer Milieumaler
| Bibliografie | |
|---|---|
| Artikel Nummer: | 0597 |
| Autor Name: | Norbert Schmidt |
| Titel des Artikels : | Stefan Jäger – ein spätimpressionistischer Milieumaler |
| Publikation: | Broschüre |
| Titel der Publikation: | Kulturtagung 1999 Sindelfingen |
| Herausgeber: | Landsmannschaft der Banater Schwaben Landesverband Baden-Württemberg |
| Erscheinungsort: | Stuttgart |
| Jahr: | 2000 |
| Seite: | 9-22 |
| * [[Norbert Schmidt]]: [[ART:0597 - Stefan Jäger - ein spätimpressionistischer Milieumaler|<i>Stefan Jäger – ein spätimpressionistischer Milieumaler</i>]]. Kulturtagung 1999 Sindelfingen. Landsmannschaft der Banater Schwaben Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart 2000 | |
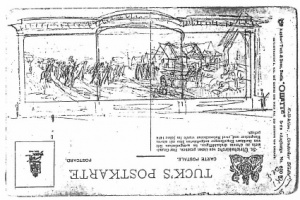
„Meine malerische Tätigkeit war hauptsächlich darauf gerichtet, meinen Landsleuten gewissenhaft ausgeführte Bilder in leicht verständlicher Form mit Motiven aus dem Banater Volksleben und der Heidelandschaft zugänglich zu machen." So lautet Stefan Jägers Bekenntnis, das er als Motto seinem Lebenswerk gab.
Diese Worte sagen alles über Inhalt und Intention seiner Bilder, aber auch über seine Methode des Ausdrucks, also alles über das Was und Wie des Dargestellten aus.
Stefan Jäger kann kurz als impressionistischer Genremaler bezeichnet werden. (Übrigens eine Kombination, die für viele Impressionisten zutrifft.) In diesem Sinne möchte ich ihm heute zwei deutsche Maler vergleichend zur Seite stellen: einen Impressionisten, Max Liebermann, und einen Genremaler, Heinrich Zille. Das war nicht spekulative Absicht, aber der Vergleich mit Malern aus Deutschland erweist sich gleichzeitig als eine Art Spätaussiedlung, oder wenn Sie so wollen, als der Versuch einer Integration Stefan Jägers post mortem in die alt-neue Heimat.
Bevor ich mich den drei Malern zuwende, drei Herren, die viel Gemeinsames an Künstlerischem und Wesenszügen haben, aber auch derart Gegensätzliches, dass nur das Extreme gemeinsam ist, lassen Sie mich zuerst über einige Begriffe des heutigen Themas etwas sagen. Vielleicht sehen wir dann einige Bilder anders. Diejenigen unter Ihnen, verehrte Damen und Herren, für die ich Eulen nach Athen trage, mögen mir das nachsehen.
Impressionismus
In der Kunst der Renaissance und des Barock eiferten die Schüler ihren Meistern nach, sie versuchten sie zu erreichen und zu übertreffen. Dass man sich vom Stil der Lehrer abwendet und lösen möchte, dass diese Ablösung Schwierigkeiten bereitet, ist ein Fall der neueren Geschichte und der Emanzipation. Im 19. Jahrhundert will der Schüler eigene Wege gehen. So entstand der Realismus und der Impressionismus als Auflehnung gegen die als staubig, salonhaft und akademisch empfundene Atelierkunst der Vätergeneration.
Der Realismus wandte sich gegen jede Form von Idealismus und strebte eine Darstellung des Diesseits, der wirklichen Welt als Realität an.
Der Impressionismus war eine Konsequenz des Realismus und des gleichzeitig steigenden Interesses für die Naturwissenschaften: Als die Maler das Atelier verließen und die Wirklichkeit im Freien suchen gingen, kamen sie ganz von selbst dazu, Licht und Farben immer schärfer zu beobachten.
Die ersten Schritte in diese Richtung taten die Mitglieder der Malerkolonie in Barbizon (Th. Rousseau, Diaz, Millet, Daubignon, Corot u.a.) und die beiden Maler, die dem Realismus die eigentliche Gestalt gaben, Gustave Courbet (1819-1877) in Frankreich und Wilhelm Leibl (1844-1900) in Deutschland. Zum wirklichen Vater der impressionistischen Schule wurde Edouard Manet (1832-1883), als er 1863 mit seinem „Frühstück im Grünen" im Salon der Refüsierten einen Kunstskandal heraufbeschwor. Er fand aber seine Jünger: Einige Jahre darauf folgten Männer wie Claude Monet (1840-1926), Edgar Degas (1834-1917), Camille Pissaro (1840-1926), Auguste Renoir (1841-1919), Alfred Sisley (1839-1899) u. a. seinem Beispiel mit der Darstellung von Szenen des zeitgenössischen Lebens und der Landschaften ihrer Umgebung. Die Bewegung war gleichzeitig von einer radikalen Änderung der Technik begleitet:
- Sie glaubten nämlich, dass das Auge nicht auf einen Blick alle Teile einer Szene gleichermaßen scharf aufnehmen kann, und zogen es daher vor, den allgemeinen Eindruck eines Motivs, einen unmittelbaren, vom Auge zufällig eingefangenen Sinneseindruck darzustellen, anstatt es Detail für Detail wiederzugeben. In ihrer Verfolgung des Ephemeren und der Lichteffekte gaben die Impressionisten allmählich die feste Form auf; in zahlreichen Kompositionen sind Häuser und Bäume nahezu in Licht aufgelöst. Sie malten nicht mehr die Dinge, sondern ihren Eindruck.
- Um der Leuchtkraft des Sonnenlichts so nahe wie möglich zu kommen, schlossen sie zuerst Schwarz aus ihrer Palette aus, dann die tonigen Erdfarben, die die zeitgenössischen akademischen Maler (und selbst Courbet) weitgehend benutzt hatten. Sie stellten auch fest, dass die Teile eines Körpers, die sich im Schatten befinden, nicht nur dunkler sind, sondern auch eine abweichende Farbe haben, und zwar die komplementäre Farbe zu der des Lichtteils, das heißt, der beschattete Teil eines gelben Körpers wird leicht violett sein, usw.
- Die Verlagerung des Ateliers ins Freie führte zum kleinen Format der Leinwand, die leicht zu tragen sein musste, und zur charakteristischen schnellen Pinselführung, denn um den flüchtigen Eindruck von Sonnenlicht und Schatten festzuhalten, musste der Maler schnell und genau arbeiten, also prima malen, wie diese Art zu malen genannt wird.
Der konsequenteste Vertreter des Impressionismus war Claude Monet. Er nannte eines seiner Bilder „Impression". Von diesem Bildtitel aus ergab sich das Kennwort Impressionismus für den ganzen Kreis. Monets Darstellungen von Heuschobern und der Fassade der Kathedrale von Rouen in verschiedenen Variationen von Klima- und Lichtbedingungen sind die typischsten von allen impressionistischen Werken.
Eine besondere Stellung nimmt Edgar Degas ein. Nie hat er mit seiner Staffelei vor einer Landschaft, in der Oper oder sonst an Ort und Stelle gestanden. Alle seine rund tausend Bilder malte er im Atelier. Sein Weg zum Unmittelbaren führt weniger über die Auflösung der Bildform in Luft und Farbe, als über die Ablösung der Bildform von der üblichen Atelierkomposition: Er hob das Gewohnte des mehr oder weniger symmetrischen Kompositionsschemas auf, indem er ein Stück Wirklichkeit asymmetrisch, bizarr und ungewohnt entwickelte und so den Eindruck des Momentanen, Impressionistischen vermittelte, so, wie wir es zum Beispiel bei der Betrachtung seiner Balletteusen empfinden.
Nach Deutschland gelangte der Impressionismus erst wirklich nach der Jahrhundertwende, und vor allem ins aufgeschlossene Berlin, wo die Vettern Paul und Bruno Cassirer in ihrer Kunsthandlung Impressionismus und Expressionismus vermittelten („Durch Manet und Monet zu money"), also zu der Zeit, als in Frankreich diese Bewegung sich bereits weitgehend aufgelöst hatte (mit Ausnahme von Monet, der die Untersuchungen von Licht und Farbe bis zu seinem Tode verfolgte). Diese Verspätung um eine Generation ist auf den deutsch-französischen Krieg 1870/71 zurückzuführen.
Zu den hervorragendsten deutschen Impressionisten entwickelten sich Lovis Corinth (1858-1925), Max Sievogt (1868-1932), Fritz von Uhde (1848-1911), Wilhelm Trübner (1851-1917) und eben „unser" Max Liebermann.
Der weitere Siegeszug des Impressionismus gen Osten dauerte dann in der Regel noch einmal eine Generation und hielt länger an.
Genrebild
Die Bezeichnung der Bildgattung ist erst seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich, in der Kunst ist das Genrebild jedoch schon in der Antike ein beliebtes Thema gewesen: denn man versteht unter diesem Begriff die Malerei von Szenen des täglichen Lebens. Wir finden es bei den Griechen, den Etruskern, den Römern, und sogar Echnaton ließ sich mit Frau und Töchtern familiär darstellen.
Später dann tauchen selbst in Szenen aus dem Leben Jesu genrehafte Züge auf: ob es im 14. Jahrhundert Konrad von Soests feueranpustender Josef oder Ghirlandaios Anna als Wöchnerin mit allem Drum und Dran oder Liebermanns Jesus als jüdischer Bengel im Tempel ist. Einen Höhepunkt erreichte die Genremalerei in Holland im 16. und 17. Jahrhundert, als die Breughels, dann Jan Steen, Vermeer, Terborch und wie sie noch alle heißen, kein Thema des profanen Lebens ausließen. Im Rokoko wurde es dann, besonders in England und Frankreich, oft frivol und erotisch, und im Biedermeier bürgerlich-behaglich, aber auch spießig, um sich dann im 19. und 20. Jahrhundert mit Malern wie Heinrich Zille, Käthe Kollwitz, Georg Grosz, Otto Dix u. a. zu sozialkritischen Anklagen gegen das Elend des Proletariats und gegen den Krieg zu entwickeln.
Die letzte Genreperiode wird stets mit naturalistischer Tendenz verbunden. Der Naturalismus ist eigentlich dasselbe wie Realismus; der allgemeine Sprachgebrauch hat aber den Naturalismus zum Komparativ des Realismus gemacht: Er ist der realistischere, der konsequentere Realismus. Die Naturalisten betrachteten die Wirklichkeit sachlicher, neutraler, mit unterdrückten Emotionen. In ihrem Thema gehen sie gelegentlich auch weiter, z. B. soziales Milieu oder blutige Schlächterläden. Realisten sind Courbet. Leibl, Trübner, und ich meine auch Stefan Jäger, Naturalisten Liebermann, der frühe Corinth und sicherlich Heinrich Zille.
Ölmalerei und Aquarell
Aquarellmalerei nennt man das Malen mit wasserlöslichen Farben auf möglichst weißem Papier. Es wird mit transparenten Farben gearbeitet: Das Weiß des Papiers leuchtet nach dem Trocknen des Wassers durch die dünne Schicht Farbe hindurch und gibt ihr eine starke Leuchtkraft. Der Malgrund selbst und sein Weiß werden dabei für die hellsten Töne benutzt, indem man den Malgrund freilässt. Das Erzeugen des Eindrucks Weiß durch Auftragen von Deckweiß bedeutet einen eigentlich unerlaubten Übergriff, einen Übergriff in den Bereich einer Abart der Aquarelltechnik, der Gouachemalerei. Auch Cezanne und der späte Corinth schufen Aquarelle, dann die Expressionisten Max Pechstein, Nolde und Erich Heckel; Aquarelle mit etwas Gouache malte Franz Marc. Das ist auch die bevorzugte Technik unseres Meisters Stefan Jäger: „Durch die Wasserfarben verlieh er seinen Bildern Leuchtkraft, Frische und Durchsichtigkeit, während er mittels der Deckfarben stoffliche Gewichtigkeit erzielte", wie Annemarie Podlipny-Hehn es treffend formulierte.
Die Ölmalerei verwendet Farben, bei denen als Bindemittel ein Ölfirnis verwendet wird. Man kann, wenn man genug von diesen Farben besitzt, sie auch zum Anstreichen gebrauchen. Von dieser Möglichkeit aus hat sich der Unterschied zwischen dem bloßen Maler und dem Kunstmaler ergeben: Der Maler streicht an, der Kunstmaler malt, oder sollte es wenigstens tun; zuweilen liegt der Unterschied nur im Material. Die Ölfarben für den Anstreicher sind mit billigem Leinölfirnis angesetzt, die Farben für die Kunstmaler mit viel teurerem und kostbarerem Öl, Mohnöl oder dergleichen. Erstens riecht es besser, zweitens trocknet es langsamer und erlaubt infolgedessen länger verbessernde Nacharbeiten, und drittens bleibt die Farbe länger bewahrt vor den Alterskonsequenzen. Der Vorteil der Ölfarben für den Maler ist der, dass benachbarte Farben auf dem Bilde nicht wie so häufig bei der Aquarellmalerei ineinanderfließen und ungewollte Mischungen ergeben, sondern sauber und geschieden nebeneinander stehen bleiben. Ja, man kann sie sogar übereinanderstreichen, ohne dass man es sieht. Die Farbe behält beim Trocknen den gleichen Charakter, sie verliert weder an Glanz noch an Leuchtkraft; beim Aquarell indessen sind die Farben nass immer schöner und leuchten tiefer als trocken. Außerdem verblassen die Farben durch Einwirkung des Lichtes in relativ kurzer Zeit. Um die Qualität des Bildes zu erhalten, müsste es eigentlich vor dem Licht verschlossen werden, um es nur zur gelegentlichen Betrachtung hervorzuholen. So bewahren Museen und Galerien ihre Aquarelle.
Aber auch die Ölbilder leuchten nicht ewig. Früher überzog man sie mit einem Schutzfirnis, der sich mit der Zeit bräunlich trübte und den so genannten Galerieton erzeugte. Mittels entsprechender Lösungsmittel lassen sich die Bilder wieder aufmuntern. Eine Aufmunterung ist jedoch nicht möglich, wenn minderwertige Farben verwendet wurden, wie es wahrscheinlich in mehreren Fällen bei Vincent van Gogh geschah. Auch die Bilder Munkácsys, bei dem ja Liebermann in die Schule ging, sind durch die Asphaltfarben, die er verwendete, schwarz bis zur Kellerlukenwirkung geworden. Etwas von diesem Nachdunkeln sieht man auch bereits auf Liebermanns frühen Bildern. Wie Jäger es mit seinem Einwanderungsbild handhabte und welche Farbqualität er verwendete, ob die Brauntönung nur auf die akademische Farbmischung oder auch auf einen Firnisfilm zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Und nun endlich zu unseren drei Künstlern.
Stefan Jäger und Max Liebermann
Der Ausbildungsweg beider Maler verläuft ähnlich, und doch ganz anders.
Von einer künstlerischen Erziehung zu Hause ist bei Stefan Jäger nichts bekannt.
Für Derartiges war ja damals in unseren schwäbischen Stuben kein Sinn, wie eben in jedem jungen, sich in der Entwicklung, im materiellen Absichern befindlichen Volksstamm. Es sei denn, sein kaufmännischer Großvater brachte aus der lieblichen Gegend seiner fränkischen Heimat ein künstlerisches Auge mit. Münnerstadt mit Riemenschneiders Magdalenenaltar liegt unweit von Königshofen im Grabfeld, jenem hübschen Städtchen mit der großen gotischen Kirche, woher die Jägers stammen.
Seine Begeisterung und sein Talent fürs Zeichnen wurde vom Zeichenlehrer Obendorf an der Szegediner Bürgerschule erkannt und gefördert. Dass dann seine Ausbildung zum Maler an der Zeichenlehrer-Bildungsanstalt in Budapest folgte, dürfte auch auf dessen Ratschläge zurückzuführen sein. Dort fand er im Klausenburger Székely Bertalan (1835-1910) einen hervorragenden Lehrer. Bei diesem Piloty-Schüler erfuhr er nicht nur den Sinn für historische Monumentalität, sondern auch das Interesse an einer zarten, impressionistisch anmutenden Darstellung. Dass er in beiden Stilen ein Meister war, beweisen die folgenden Gemälde Skékelys:
- „Die Auffindung des Leichnams Ludwig II. nach der Schlacht von Mohács" (interessant festzustellen, dass seinem Lehrer Piloty der Durchbruch als Historienmaler mit „Seni an der Leiche Wallensteins" gelang)
- „Die Tänzerin"
Sie sehen also, hier finden die beiden Antipoden der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts, das Monumentale und das Spontane, zusammen.
Über Jägers weiteren Werdegang, zum Beispiel über seine Studienreisen nach Deutschland, Österreich und Italien nach seiner Budapester Ausbildung, so wie später über seine Person weiß man kaum etwas. Zu bescheiden und scheu lebte er in seiner kleinen Heideumgebung, zu wenig beachtet und geachtet wurde er von seinen Zunftbrüdern und Landsleuten. Nur für kurze Zeit trat er hervor und merklich in unser Bewusstsein. Es waren die Jahre der Ausführung des Auftrags aus Gertjanosch über ein Gemälde zum Thema „Die Ansiedlung der Deutschen im Südosten". Zwischen 1906 und 1910 entstand dann „Das Einwanderungsbild", sein Hauptwerk, 6 Meter lang und 1,5 Meter hoch. Wir kennen es alle.
Es ist ein monumentales Historiengemälde, ein Meisterwerk in gekonnter akademischer Manier, in Form eines Triptychons mit Simultandarstellung. Es ist ein geschichtlich-ethnographisches Dokument von höchstem Wert (es sei nur am Rande bemerkt, dass in der gleichen Zeit in Deutschland die Expressionistenbewegungen „Blauer Reiter" und „Die Brücke" entstanden sind, und in Frankreich die „Fauves" aufzutreten begannen).
Dieser Auftrag brachte ihm außer viel Anerkennung und weniger Geld auch eine Studienreise nach Deutschland ein. Denn zuerst schuf Jäger ein Gemälde, bei dem ihm ein Anachronismus unterlaufen ist: Die Einwanderer trugen darauf nicht die zeitgemäße Tracht. In einem neuen Gemälde sollte das nun wieder gutgemacht werden, indem dem Maler eine Reise nach Deutschland ermöglicht werde, mit dem Zweck, die Trachten unserer Vorfahren zu studieren (dafür sammelten die Gertjanoscher 465 Dukaten, soviel also wie damals 4,5 Waggons Weizen kosteten).
Die Geschichte dieses Bildes ist ein Beispiel dafür, dass auch von der Historienmalerei ein Kraftstrom des Realismus stammte. Mit dem Betonen des Zeitkostüms und seiner Richtigkeit führte sie ebenfalls ins Realistische, ja sogar ins Naturalistische.
Nach dem großen Erfolg mit dem Einwanderungsbild wurde es aber schnell wieder still um Stefan Jäger. Mit Bestellungen von Heiligenbildern und Idyllen und ab und zu auch von Porträts reicher Großbauern hielt er sich und seine Mutter über Wasser.
Ein Gutes hatte das Einwanderungsbild noch: Seitdem beginnt Jäger sich intensiv mit der Welt und dem Schaffen der Banater Menschen auseinanderzusetzen. Er zieht sich nach Hatzfeld zurück und vertieft sich in ein gründliches, systematisches Studium des Banater Volkslebens. Durch unzählige Skizzen und Gemälde, eben Genre- und Heimatbilder, in einer impressionistischen Malsprache verfasst, ermalte er sich das Prädikat unseres „Schwabenmalers".
Sehen wir mal rüber, was Max Liebermann macht.
Er ist 30 Jahre älter als Jäger und entstammt einer begüterten Fabrikanten- und Kaufmannsfamilie in Berlin. Sein Vater ist nicht glücklich, als sein zweiter Sohn Max Maler werden will, anstatt ins Geschäft einzutreten. Aber als sein Talent entdeckt wurde, erhielt er Privatunterricht (bei Karl Steffek). Seine Ausbildung und künstlerische Entwicklung waren von sehr vielen Studienreisen geprägt: In Weimar begeisterte ihn ein Lehrer (Theodor Hagen), dem er sogar nach Düsseldorf folgte. Dort fand er Zutritt zum Atelier Munkácsys und sieht das Gemälde „Die Charpiezupferinnen", dessen Realismus ihn stark beeindruckte (er fühlte sich „mächtig angezogen"). Im Jahr darauf 1872 malt er in Holland „die Gänsezupferinnen" (Sie erinnern sich noch an Piloty und Székely?), ein Gemälde, das einen großen Aufruhr über die ungeschönte Wiedergabe der Wirklichkeil hervorruft (A. Rosenberg: „Abschreckende Hässlichkeit in unverhülltester Abscheulichkeit").
Es folgten im Laufe der Jahre Reisen nach Paris, vor allem wegen der Barbizon-Realisten, insbesondere wegen Millet, und später wegen der Impressionisten. Aber ein Versuch (1874), in den Kreis der Pariser Künstler eingeführt zu werden, scheitert, da diese alle Deutschen mieden. Und im Gegenzug, als ihm 1889 in Paris die Ehrenmedaille verliehen und die Ernennung zum „Ritter der Ehrenlegion" angetragen wurde, musste er auf Geheiß der preußischen Regierung ablehnen. Sie verstehen jetzt, warum der Impressionismus so spät in Deutschland Fuß fasste.
Liebermann bereiste öfter und für längere Zeit Holland, dann Italien, Österreich, und immer wieder Paris und München. Er lernte dabei die bedeutendsten Künstler seiner Zeit kennen und schätzen. Zum Schluss (1884) ließ er sich, nein, nicht in Hatzfeld, in Berlin nieder, der aufblühenden und mondänen Metropole Deutschlands. Dort ließ er nach einer Millionenerbschaft den Familiensitz am Pariser Platz 7, gleich neben dem Brandenburger Tor, mit einem Atelier erweitern, bei welcher Gelegenheit er sich sogar mit dem Kaiser anlegte.
Im Laufe der Zeit wandelte er sich vom Kulturrebellen, „Schmutzmaler", vom „Maler der armen Leute" („Kartoffelernte", „Korbflechterinnen", „Konservenarbeiterinnen", „Flachsscheuer" u. v. a.), geprägt von einem nüchternen Naturalismus, zum Maler des Bürgertums und der mondänen Welt (Strandszenen, Judenviertel in Amsterdam, Tier- und Biergärten, Wannseegärten, viele Selbstporträts und Porträts des reichen Industrie- und Bankadels; es galt als Muss für einen reichen Berliner Juden, sich von Liebermann malen zu lassen), wobei er seinen eigenen impressionistischen Stil entwickelte. (Das heißt aber nicht, dass sich Liebermann von den armen Leuten abwandte, wofür die Zuneigung und Unterstützung Zilles ein Beweis ist.)
Wie auch Jäger wandte er sich dabei nicht wie viele andere Künstler seiner Generation brüsk vom Stil der Väter ab, sondern lernte vielmehr behutsam von den französischen Impressionisten und benutzte deren Errungenschaften, so die Lichtregie, zur Belebung seiner Kunst.
Die Aufspaltung der Farben à la Monet entspricht in keinem Fall der Malerei Liebermanns: „…das mit den zerlegten Farben, das ist alles Unsinn, … die Natur ist einfach grau". Seine Bilder enthalten immer eine Nuance Grau und Erdfarben.
Bevor wir nun zur Ansicht einiger Bilder von Jäger und von Liebermann kommen, möchte ich noch auf die Rolle der Bilderrahmung bei beiden Malern hinweisen. Noch aus der Salonmalerei stammen die Maßstäbe für die Rahmung der Bilder, Maßstäbe, die sowohl bei Jäger als auch bei Liebermann weiterhin galten. Liebermann ist bekannt dafür, dass er zuweilen die Bilder bereits im Rahmen malte, nicht nur den letzten Schliff, sondern von Anbeginn. Zum Beispiel in „Die Papageienallee" ist ihm der Pinsel über das Bild hinaus geglitten und hinterließ Spuren auf dem Rahmen, oder in einem Selbstbildnis sind die Ränder teilweise unbemalt geblieben; in einem Selbstbildnis sitzt er malend vor einem gerahmten Bild. Sein Motto „Erst im Rahmen sind Bilder schön" galt auch für Jäger. In der Korrespondenz mit Kunden pflegte er eine Skizze von den bestellten Bildern samt Rahmungsvorschlägen zu machen. Auch sein Konzept für das Einwanderungstriptychon beinhaltete die Vorstellung vom Rahmen. Das zeigen zwei flüchtige Skizzen auf den Rückseiten von Karten, die er vermutlich während des Studienaufenthaltes in Deutschland anfertigte.
Hier nun einige Bilder gegenübergestellt:
Jäger Liebermann
- Detail Einwanderungsbild (1910) - Altmännerhaus A'dam (1880)
- Mädchen auf Feldweg - Kuhhirtin (1890)
- Baumgruppe - Allee in Overveen (1909)
– Feldweg - Dünen und Meer (1909)
- Hühnerhof - Papageienallee (1902)
- Markt (Aquarell) - Gemüsemarkt in A'dam
- Markt (Öl) - Judengasse in A'dam (1907)
- Markt in Hatzfeld - Judengasse in A'dam (1909)
- Blumengarten am Haus - Wannseegarten (1928)
- Skizze Einwanderungsbild - Am Strand von Scheveningen
- Brief an Kunden - Papageienallee (Rahmen)
- Skizze auf Kartenrückseite - Selbstbildnis (Rahmen)
Die Gegenüberstellung Jäger - Liebermann möchte ich mit der Feststellung beenden, dass ihre Erfolgswelle – denn von einer solchen kann man wohl sprechen – sozusagen phasenverschoben verlief.
Recht vielversprechend begann Jägers Laufbahn mit dem Einwanderungsbild, dann folgte aber eine lange Zeit der fehlenden Beachtung und Armut, um dann fast zu spät noch mal in seinen letzten Lebensjahren als großer Künstler „staatlich anerkannt" zu werden.
Max Liebermann musste sich viele Anfeindungen gefallen lassen, bis er dann fast schon 50-jährig große Anerkennung, Ehrung und Beliebtheit in seiner Heimatstadt erfuhr. Seine Beliebtheit währte bis zum Beginn der Nazizeit, als er als Jude verfemt und seine Malerei diffamiert wurde. Aus dieser Zeit stammt sein Spruch „Ich kann gar nicht so viel fressen, wie viel ich kotzen möchte". Er ist doch ein Naturalist geblieben!
Und nun ein kleines Intermezzo.
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Jäger in seinen Skizzen sich als größeren Meister vorstellt. Sie sind der lebende Beweis für Liebermanns Worte über die Wichtigkeit der Skizze: „In der Skizze feiert der Künstler die Brautnacht mit seinem Werk; mit der ersten Leidenschaft und mit der Konzentration aller seiner Kräfte ergießt er sich in die Skizze, was ihm im Geiste vorgeschwebt hat, und er erzeugt im Rausche der Begeisterung, was keine Mühe und Arbeit ersetzen könnte". Demnach also fand Stefan Jäger Ersatz in seinem Junggesellenleben.
Den Skizzen gegenüber wirken dann die im Atelier entstandenen, wiederholt gemalten Bilder oft etwas gestellt, gekünstelt, etwas affektiert und manieriert, eben wie es seinen schwäbischen Landsleuten gefiel. Zum Überleben musste er derartige Zugeständnisse machen. Hier in zwei Beispielen:
- Drei Mädchen auf der Bank
- Dorfstraße am Sonntagvormittag
erkennen wir leicht Unregelmäßigkeiten, die komisch wirken. Wir dürfen diese aber nicht überbewerten, befindet er sich damit doch in bester Gesellschaft:
- Cézannes „Jüngling" mit dem langen Arm, zu dem Max Liebermann bemerkte, „dieser Arm ist so schön, dass er gar nicht lang genug sein kann".
- Auf Angelika Kaufmanns „Plinius d.J. mit seiner Mutter" finden wir zwei richtige linke Füße.
- In diesem Jahr war es überall zu sehen: Tischbeins „Goethe in der Campagna". Füße sind schwer zu malen.
- Etwas einfacher hat es sich der Heppenheimer Horst Antes mit seinem Kopffüßler-Goethe gemacht. Die Hauptsache ist ja der Hut.
- Und Cy Twombly mit seinem „Goethe in Italien". Auf das Wesentliche kommt es an.
Und damit haben wir gleichzeitig die Reverenz unserem Dichterfürsten erwiesen.
Stefan Jäger und Heinrich Zille
Wenn wir Jäger und Zille vergleichen, so nicht wegen des ähnlichen Malstils. Die Themen sind es, die so ähnlich und doch so ganz anders sind. Beide sind Genremaler und die Maler ihrer Umgebung: Jäger unser Schwabenmaler und Zille der des Berliner „Milljöhs".
Derweil stammte Zille gar nicht aus Berlin. Gebürtiger Sachse aus Radeburg bei Dresden war er, von wo seine Familie 1867 nach Berlin floh. Sein Vater war nämlich Schmied und Pleitier, und musste seinen ihm nachstellenden Gläubigern entkommen, seine Frau und Kinder sich selbst überlassend. Mit allerlei Botendiensten half der 9-Jährige Heinrich mit, das Leben im Berliner Osten zu meistern. Seinen Unterricht bei einem Zeichenlehrer bezahlte der 11-Jährige mit selbstverdientem Geld, und auf dessen Rat begann er später die Lehre als Lithograph: Da sitze man in der warmen Stube, brauche nicht zu schwitzen. „Und dann wirst du mit Sie angeredet. Was willst du mehr?"
Es war die Zeit nach dem siegreichen Deutsch-Französischen Krieg, die Zeit der „Gründerjahre", die uns beim Anblick vom letzten Krieg verschont und erhalten gebliebenen Häuserzeilen mit den hohen, gefälligen Fronten Behaglichkeit und aufkommenden Wohlstand damals suggerieren. Aber Zille zeichnete Bilder, die die ungeschönte Wirklichkeit einer anderen Seite dieser Zeit zeigt: das Leben in den Hinterhöfen der Massenbauten, Elendsquartiere in feuchten Wohnungen und nassen Kellern.
Abends ging Zille zum Unterricht zu Professor Hosemann, ein damals berühmter Maler des Berliner Kleinbürgertums. Und von Hosemann kam der entscheidende Hinweis: „Gehen Sie lieber auf die Straße hinaus, ins Freie, beobachten Sie selber; das ist besser, als wenn Sie mich kopieren".
… Und Zille ging hinaus auf die Straßen des Berliner Ostens, auch dann noch, als er in Berlin-Charlottenburg in bescheidenem Wohlstand wohnte, und auch dann noch, als er ordentliches Mitglied der „Preußischen Akademie der Künste" war, (übrigens vor allem auf den Vorschlag ihres damaligen Präsidenten, Max Liebermann, hin).
Man hat Zille einen Humoristen genannt. Es wäre treffender, ihn als Künstler mit Humor zu bezeichnen. Er war durchdrungen von jenem Humor, der nicht bloß auf Witz und Lachen abzielt, der von der Art ist, dass man „trotzdem lacht" und mit diesem Lachen die Trostlosigkeit des Alltags überwindet. Zille hatte selbst erlebt, dass auch das armseligste Leben nicht Stunde um Stunde armselig ist, dass es sich, wie jedes andere, zusammensetzt aus Höhen und Tiefen und allen Stufen dazwischen.
Die Unbetroffenen schätzten ihn nicht überaus. Sie warfen ihm „Verunglimpfung Berlins und seiner Bewohner" vor und: „Der Kerl nimmt einem ja die ganze Lebensfreude"; das völkische Blatt „Friedericus" nannte ihn einen „Abort und Schwangerschaftsmaler" und schrieb: „Verhülle, o Muse, dein Haupt". In seinem „Milljöh" des „fünften Standes, der Vergessenen", wie er es nannte, aber nannte man Kinder nach ihm, war er Vertrauter auch von Huren und Asozialen, die ihm nicht geringer schienen als andere Menschen; da war er der „Pinselheinrich" und „Vater Zille".
Wie anders war doch Jäger! Er war kein Vertrauter seiner Mitmenschen, er stürzte sich nicht mitten ins Volksgetümmel, er stand lieber beobachtend und skizzierend abseits, und ging als „Herrischer" einher. Er war scheu und schien gehemmt und unsicher im Umgang mit Unbekannten oder nicht Ebenbürtigen gewesen zu sein. Er siezte Vierzehnjährige und hatte den Ruf, nicht zugänglich zu sein. Dieser Ruf schreckte dann wieder interessierte und interessante Gesprächspartner davor ab, auf ihn zuzugehen. Leider erst spät entdeckte man bei ihm Gesprächsfreudigkeit und Herzlichkeil, und zu selten suchte man dann nach Gelegenheilen, diese auszuschöpfen.
Stefan Jäger war ein rastloser Wanderer durch Feld und Flur, nahm als stiller Gast an allen Festen und Handlungen in seiner näheren und manchmal auch weiteren Umgebung teil. Unzählige Gemälde sowie hunderte von Aquarell-, Tusch- und Bleistiftskizzen stellen eine farbenfrohe, lebendige und vollkommene Dokumentation zur Volkskunde der Banater Schwaben dar.
Lassen wir nun einige Bilder von Stefan Jäger und Heinrich Zille selbst sprechen. Es wird uns dabei sicherlich nicht der große Kontrast zwischen den beiden Welten, Banat und Berlin, entgehen.
- hier Arbeit und Feierabend, Mehrgenerationenhaushalt, Einkindsystem; hier arbeiten und unterhalten sich die Großen, während die Kinder von den Großmüttern behütet werden, Wohlstand und heile Welt, selbst dann, als der schwäbische Bauer durch Enteignung sich in Notstand geraten glaubte
- dort Armut, Elend, Arbeitslosigkeit, Haufen von Kindern, das Fehlen von alten Leuten, weil die Lebenserwartung so niedrig war.
Ein Kontrast, zu dem ein anderer in Widerspruch zu stehen scheint, nämlich, dass es Zille stets besser und Jäger stets schlechter als ihren jeweiligen Modellen ging.
Hier nun einige Bilder gegenübergestellt:
Jäger Zille
- Studie Großmütter, Mütter, Kinder - Zille und seine Modelle
- Mädchen vor dem Spiegel - Rockraffendes Mädchen
- Großmütter mit Enkeln - Große und ...
- Junge Mutter mit Kind - ... kleine Mütter
- Drei Mädchen in Tracht - Drei Mädchen
- Studie Schnitterin und Schnitter - Straße als Spielplatz
- Heuernte - Wollt ihr weg von die Blumen
- Arztbesuch - Arzt und Kinder
- Mäusejagd - Wanzenjagd
- Heimkehr vom Feld schwäbischer Bauer - Lohntag
- Heimkehr Banater Rumänen - Feierabend
- Heimkehr rumänischer Bauern (C. Baba) - In die Ferienkolonie
- Fronleichnamsvorbereitung - Erntedankfest
- Bei der Vortänzerin - Tanz in der Kaschemme
- Tanz im Wirtshaus - Tanzendes Paar
- Neckendes Paar - Die Venus mit dem Pelz
Bevor ich zur abschließenden Würdigung Stefan Jägers komme, möchte ich mich noch für die schlechte Qualität mehrerer Jäger-Dias entschuldigen. Es liegt hauptsächlich an den Reproduktionen in den bisher erschienenen Büchern und Kalendern, die ich als Vorlage benutzte. Ich ergreife aber dieses Manko gleich als Gelegenheit, Franz Liebhards Anliegen aus 1977 über die Erstellung eines Buches mit Jägers Werken zu aktualisieren, und wiederhole seine damalige Frage, „... wer wohl Kraft und Begeisterung aufbrächte, mit diesem Buch unsere Bevölkerung zu beschenken."
Wir Banater Schwaben dürfen es als Sternstunde unseres Kulturlebens empfinden, dass uns ein Dokumentarist vom Range Stefan Jägers beschieden war. Ob Jägers Natur ihn dazu veranlasste, sich nach Hatzfeld zurückzuziehen, oder ob Hatzfeld ihn so geprägt hat? Wer weiß das, vielleicht haben sich beide Gründe potenziert. (Kunst-)Historiker schätzen kontrafaktische Betrachtungen wenig.
Dennoch, was wäre:
- wenn Jäger an der Budapester Akademie hätte ausgebildet werden können oder wollen
- wenn er in akademische Künstlerkreise geraten wäre mit weiterer Ausbildung in München oder Paris
- wenn er in eine der vielen Künstlerkolonien „entführt" worden wäre oder einer Sezession „verfallen" wäre
- wenn er nicht heimatverbunden, stattdessen ein offener Weltbürger gewesen wäre, und sich in einer großen Stadt, Budapest oder „gar" in Temeswar niedergelassen hätte
- wenn er seiner impressionistischen Malweise nicht treu geblieben wäre
- wenn, wenn, wenn…
Er wäre vielleicht in der großen Masse der Anpasser und der Neuerer-Nachahmer untergegangen und uns vielleicht unbekannt geblieben. Wer hätte dann die 250 Jahre lange Kulturgeschichte eines kleinen Volksstammes geschrieben? Eines Volksstammes, der im deutschen Mitteleuropa seine Wurzeln hatte und irgendwo auf dem Balkan untergegangen ist: der Banater Schwaben.
Literaturverzeichnis:
Cogniat, Raymond: Das Jahrhundert der Impressionisten. Köln/Mailand [ohne Jahr].
Fechter, Paul: Kleines Wörterbuch für Kunstgespräche. Gütersloh 1951.
Gross, Karl-Hans: Stefan Jäger - Maler seiner heimatlichen Gefilde. Sersheim /Mannheim 1991.
Hansen, Dorothea: Max Liebermann - Der deutsche Impressionist. München 1996.
Liebhard, Franz: Begegnungen mit dem Meister. In: Neue Banater Zeitung vom 26. Mai 1977.
Malereilexikon. Zug 1986.
Nagel, Otto: H. Zille. Berlin 1955.
Podlipny-Hehn, Annemarie: Stefan Jäger. Bukarest 1972.
Reinoß, Herbert: Das neue Zille-Buch. Stuttgart 1974.